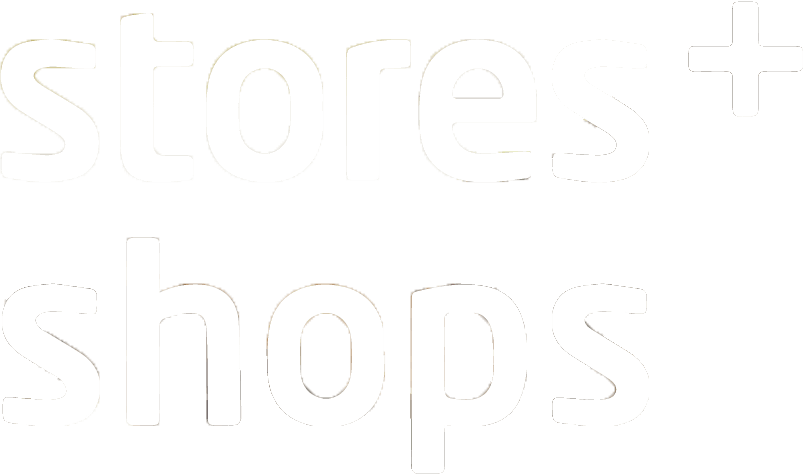Ware auf das Band, Ware durch den Erfassungstunnel, Ware eingepackt: Mitte 2012, mit dem Start des Pilotprojektes in einem Rewe-Regiemarkt in Zülpich bei Köln, rückte die Vision eines vollautomatischen Checkouts in den Bereich des Möglichen. In den letzten Monaten allerdings dringen kaum noch Informationen über den Test in die interessierte Öffentlichkeit.
„Diese Ruhe ist mit höchster Konzentration bei der Fertigstellung der Lösung verbunden – es sind jetzt die kleineren, aber wichtigen Details, die im Prozessablauf abgestimmt werden“, erklärt Gordon Klein, Solution Manager Automated Checkout bei Wincor Nixdorf. In Zülpich und außerdem in einem Markt des schwedischen Handelskonzerns ICA hat der Paderborner Technologie-Dienstleister sein im Jahr 2011 vorgestelltes „360 Grad-Scan-Portal“ aufgebaut. „Die Piloten haben die grundsätzliche Einsatzfähigkeit der Lösung bestätigt, sie werden jetzt teilweise ausgeweitet, und dabei fließen sukzessive die Verbesserungen mit ein“, berichtet Klein.
Verbesserte Erkennungstechnologie
Wird der Tunnelscanner also im Jahr 2020 oder schon früher die Praxisreife erlangt haben? Zunächst und in erster Linie muss dazu die Erfassungsrate gesteigert werden, auf mindestens 99 Prozent. Denn hiermit steht und fällt die Lösung. Sie macht für den Handel nur Sinn, wenn die Zeitersparnis durch das automatische Scannen nicht durch zusätzlich notwendige manuelle Arbeiten zunichte gemacht wird. Um sich dem Höchstwert anzunähern, muss die gesamte Palette technischer Möglichkeiten aufgefahren werden.
Der anfängliche Versuch, ausschließlich auf EAN-Barcode-Erfassung zu bauen, hat sich als nicht praktikabel erwiesen. Mit dem Einbau von Kameras für die 2-D-Identifikation ist die Erkennungsrate nach Angaben von Datalogic, Technologie-Partner von Wincor Nixdorf bei diesem Projekt, aber immerhin auf inzwischen 97 Prozent gestiegen.
Die Hoffnungen ruhen nun auf der sogenannten VIPR-Technologie. Mit „Visual Pattern Recognition“ können fotografierte Objekte erfasst und erkannt werden. Das System ist mit einer Selbstlernfunktion ausgestattet. Sie soll dabei helfen, Objekte zu identifizieren, die nicht mit Barcode ausgezeichnet sind und die sich gleichen – etwa Äpfel unterschiedlicher Sorten in einer Verpackung. „Wir gehen davon aus, dass durch die Selbstlernfunktion eine Erkennungsrate von hundert Prozent erreicht werden kann“, hofft Jan Walker, Regional Director DACH bei Datalogic.
Nachdem IBM und NCR ihre in den 1990er-Jahren begonnenen Versuche mit Tunnelscannern eingestellt haben, befassen sich inzwischen neben Wincor Nixdorf lediglich Fujitsu und der schwedische IT-Anbieter ITAB mit dem Thema. Die „Easy Flow“ genannte ITAB-Lösung wurde auf der EuroShop 2011 erstmals vorgestellt. In einem Tunnel von 60 cm Länge sind insgesamt 9 Erkennungseinheiten installiert: 6 Bildprozessoren, eine Waage sowie 2 Objektsensoren, die mit Spektralanalyse die Oberflächenstruktur eines Artikels identifizieren. Alle Erkennungstechnologien werden gleichzeitig aktiviert. Damit kann eine Erkennungsrate von 99 Prozent erreicht werden, verspricht Detlef Rohlender, Geschäftsführer von ITAB Germany. Seit Mai 2013 durchläuft „Easy Flow“ einen ersten Praxistest im Raum Benelux, so das Unternehmen.
Erster Test bei The Kroger
Der weltweit erste Praxistest mit einem vollautomatischen Checkout startete Anfang 2010, als The Kroger, nach Walmart der zweitgrößte Lebensmittelhändler in den USA, in seinem Markt in Hebron im Bundesstaat Kentucky einen automatischen Scanner installieren ließ – einen Eigenbau mit Komponenten von IBM, Fujitsu und anderen Technologieanbietern. Kroger und Fujitsu erhielten dafür seinerzeit den Innovation Award der National Retail Federation Convention (NRF), die Technologie wurde von Fachpresse und Branche euphorisch kommentiert.
Der Test allerdings dauert an, und von Euphorie ist inzwischen nichts mehr zu spüren. Auch nicht bei Ralf Schienke, Sales Manager Retail Deutschland bei Fujitsu Technology Solutions. Die Erfahrungen aus dem Kroger-Test bewertet er zumindest zwischen den Zeilen eher skeptisch (siehe Interview). Fujitsu, weltweit an zweiter Stelle bei der Installation von SB-Checkouts, will das Projekt „Automated Checkout“ jedoch auch weiterhin in seinem technischen Portfolio behalten. Für den Fall, dass es der Tunnelscanner auch in den kommenden Jahren nicht auf die Fläche schafft, spendet er schon vorab Trost: „Bezogen auf Investition, Grundflächenverbrauch und Handling gibt es aus unserer Sicht bewährte Alternativen, die sich rechnen“, erklärt der Fujitsu-Manager.
Fotos: Wincor Nixdorf (1), ITAB (1)
 „Auch der Kunde muss sein Tempo erhöhen“
„Auch der Kunde muss sein Tempo erhöhen“
Ralf Schienke, Sales Manager Retail Deutschland bei Fujitsu Technology Solutions, über die Erfahrungen mit dem Tunnelscanner bei The Kroger.
Welche Erkenntnisse zieht Fujitsu aus der Testphase bei The Kroger?
Um Tunnelscanner erfolgreich einsetzen zu können, sollte die durchschnittliche Lese- und Erkennungsrate mindestens 99 Prozent und die Bandgeschwindigkeit rund 25 Meter pro Minute betragen. Waren, die nebeneinander auf dem Band liegen und sich teilweise verdecken, müssen mit derselben Rate erkannt werden können.
Wann wird die Bandgeschwindigkeit zum Problem?
Bei hoher Geschwindigkeit des Bandes muss die gescannte Ware schnell separiert bzw. entnommen werden, damit der Ablagebereich nicht voll belegt wird und der Scan-Vorgang wegen Rückstau gestoppt werden muss. Dieses Problem wird in den USA mit zusätzlichem Personal am Ende des Bandes sowie mit ausreichend großen Fächern gelöst. Die dort auch am traditionellen Checkout üblichen Mitarbeiter zum Einpacken der Waren sind allerdings für deutsche Konsumenten ungewohnt, auch sind sie natürlich ein Kostenfaktor.
Wie reagieren die Kunden?
Verlagert man zu viel Handling auf den Kunden und gibt ein hohes Tempo vor, kommt es schnell zu Stress-Situationen. Die Waren auf das Band legen, die gescannten Waren am Ende der Linie im Auge behalten, bei freizugebenden Artikeln mit dem Personal kommunizieren und die Bezahlung vorbereiten, ist für manchen Kunden vielleicht etwas viel auf einmal. Tunnelscanner machen aber nur als „Autobahn“ Sinn. Das heißt: Auch der Kunde muss sein Tempo erhöhen, wenn die Investition für den Händler aufgehen soll.