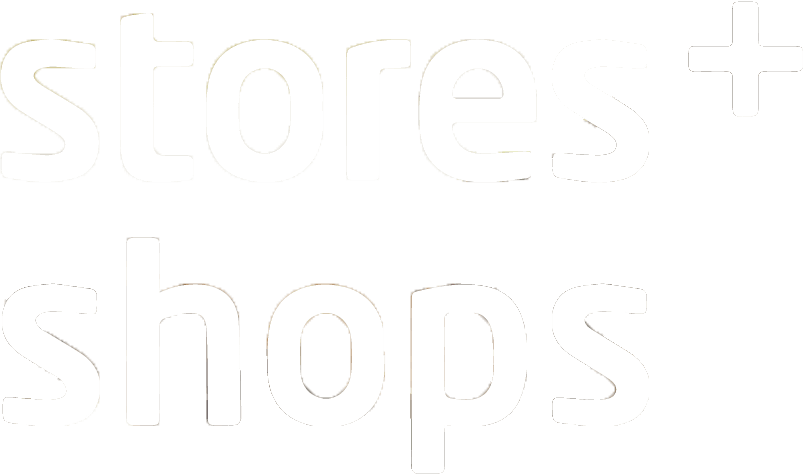Weder zu heiß noch zu kalt: Für eine optimale Steuerung der HLK-Systeme müssten Facility-Management-Teams sämtliche Werte ständig im Blick behalten und auf jede kleine Veränderung sofort reagieren. Mit menschlichem Vermögen ist das nicht zu schaffen. Im Zweifel läuft die Heizung weiter wie bisher. Hier setzen Anbieter wie Aedifion und Recogizer an: Sie nutzen Künstliche Intelligenz (KI), um Verluststellen aufzudecken, den Anlagenbetrieb zu optimieren und ungenutztes Einsparpotenzial zu heben. Im Kern bieten die Unternehmen Software-Lösungen an, die mit einer bestehenden Gebäudetechnik verbunden werden. Dabei agieren sie meist als Full-Service-Dienstleister, die bei Bedarf auch die Nachrüstung mit Hardware durch externe Technikpartner koodinieren . „Wir liefern eine komplette Regelstrategie,um Ihre klimatechnischen Anlagen bestmöglich zu steuern“, wirbt Carsten Kreutze, CEO von Recogizer aus Bonn. Einen bildhaften Vergleich findet der Geschäftsführer des Kölner Prop-Tech-Unternehmens Aedifion, Johannes Fütterer: „Stellen Sie sich unsere Lösung als einen hochdynamischen,gut informierten Hausmeister vor, der nie schläft und an allen Knöpfen gleichzeitig drehen kann.“
Die Basis bilden jede Menge Daten. Diese werden über eine Vielzahl von Datenpunkten im Gebäude erhoben und in einer Cloud gespeichert. Dazu zählen Raumtemperaturen, Luftqualität, Sonneneinstrahlung, Besucherströme sowie anlagentechnische Betriebsdaten wie Vor- und Rücklauftemperaturen oder Drehzahlen von Ventilatoren.
Mithilfe der KI lassen sich klimatechnische Anlagen vorausschauend steuern.
Johannes Fütterer
Prädiktive Regelung
„Diese Daten fließen in ein selbstlernendes Gebäudemodell“, erläutert Fütterer. „So erfahren wir etwa, wie lange ein Gebäude zum Aufwärmen oder Abkühlen benötigt. Diese und viele weitere Informationen nutzt das System, um das Gebäude optimal zu steuern – und das vorausschauend“. Hierfür können Wetterprognosen oder Raumbelegungspläne ins Modell integriert werden. „Prädiktive Regelung“ wird dieser Ansatz bezeichnet.

Die Heizungsanlagen machen in Immobilien einen Großteil des Energieverbrauchs aus.
Foto: Dmytro Tomson/iStock.com
Ein vereinfachtes Beispiel: Jeden Tag versammeln sich zu einer festen Uhrzeit an einem bestimmten Punkt im Gebäude gut 500 Menschen. Ein solcher Ort könnte der Food Court eines Shopping-Centers sein. Da menschliche Körper Wärme abgeben, kann die Heiztemperatur zu dieser Stoßzeit gesenkt werden. Das spart Energie und sorgt für ein angenehmeres Raumklima – insbesondere, wenn abzusehen ist, dass am nächsten Tag der Sommer in die Stadt einkehrt.
Gutes Facility Management greift manuell ein, eine Gebäude-KI regelt autonom. Auch dann, wenn sich die Vorhersagen als falsch erweisen und sich unerwartet weniger Menschen im Center einfinden. „Das System reagiert auf Schwankungen im laufenden Betrieb. Alle 15 Minuten wird die Regelstrategie angepasst. Händisch wäre dies unmöglich“, so Carsten Kreutze.
In der Realität sind die Regelprozesse vielfach variabler und komplexer. Außerdem überwacht das System alle Bereiche gleichzeitig. Die Regelung lässt sich an die thermischen Gegebenheiten einzelner Ladenflächen sowie klimatischen Anforderungen unterschiedlicher Nutzungsarten anpassen.
Unter den ESG-Managern gilt die KI-Steuerung als „Low-Hanging Fruit“ unter den Nachhaltigkeitsmaßnahmen für Wirtschaftsimmobilien. Ob und wie schnell eine Implementierung möglich ist, hängt von den technischen Voraussetzungen einer Immobilie ab. Ist eine Gebäudeautomation vorhanden, lasse sich das System zügig integrieren. Müssen Anlagen erst vernetzt und digitalisiert werden, dauere es entsprechend länger. Wichtig in diesem Zusammenhang: eine Infrastruktur mit digitalen Energiezählern, die Verbräuche kontinuierlich auswirft. „Verglichen mit anderen Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz sind wir sehr schnell“, sagt Recogizer-CEO Kreutze. Johannes Fütterer von Aedifion wird zeitlich konkreter: „Unser System ist in etwa 30 bis 60 Tagen online.“ Erste Verbrauchsreduktionen seien jeweils nach relativ kurzer Zeit feststellbar.
Das heißt nicht, dass sofort das Optimum herausgeholt wird. Fütterer verweist auf eine sechs- bis neunmonatige Setup-Phase, um „alle relevanten Lastfälle im Gebäude einmal zu erleben“. „Wir erfassen die Energieverbräuche über drei Jahreszeiten hinweg. In dieser Zeit wechselt sich die optimierte Regelung mit der Lernphase für die Modelle ab“, führt Kreutze aus.
Im Durchschnitt senken die Systeme den Energiebedarf um 22 Prozent (Aedifion) bzw. 28 Prozent (Recogizer), Spitzenwerte liegen bei 40 Prozent, geben die Softwareentwickler an. Was das unter dem Strich bedeuten kann, rechnet Aedifion anhand des Ettlinger Tors in Karlsruhe vor: 2023 sparte das von der ECE gemanagte Einkaufszentrum (Baujahr 2005, Mietfläche 38.800 qm) durch die Optimierung der Raumlufttechnik sowie die prädiktive Steuerung der Heizkreise Betriebskosten in Höhe von 57.000 Euro ein.
Die digitale Verfügbarkeit eröffnet viele Anwendungsszenarien.
Carsten Kreutze
Amortisation in zwei Jahren
Den Einsparungen gegenüber stehen Einmalinvestitionen, die laut den Anbietern in der Regel bei wenigen Tausend Euro liegen. Wo direkt auf ein bestehendes, technisch geeignetes Automationssystem aufgesetzt werden könne, entstünden keine Investitionskosten. Umgekehrt könne die Nachdigitalisierung älterer Gebäude fünftstellig zu Buche schlagen. Der laufende Betrieb wird über ein Abonnement abgedeckt: Die Kosten liegen im niedrigen Cent-Bereich pro Quadratmeter und Monat. Die Anbieter prognostizieren eine Amortisation innerhalb von 12 bis 24 Monaten.
Die Nachfrage nach KI-gestützten Gebäudelösungen steige drastisch an. Dies zeige sich sowohl in der Anzahl direkter Anfragen als auch bei Ausschreibungen großer Asset und Property-Manager. Neben der EU-Taxonomie und den damit verbundenen Anforderungen an nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten spielten auch regulatorische Vorgaben eine Rolle. „Unsere Lösung stellt sicher, dass der Eigentümer weiß, wo alle Daten für sein ESG-Reporting liegen“, betont Johannes Fütterer. Er und Kreutze verweisen auf § 71a „Gebäudeautomation“im Gebäudeenergiegesetz (GEG) sowie die zugrunde liegende EU-Gebäuderichtlinie (EPBD). Im GEG wird die Ausstattung von Nichtwohngebäuden mit digitaler Energieüberwachung vorgeschrieben – aktuell bei Heiz- oder Kühlanlagen ab einer Nennleistung von 290 kW. Die jüngste Novelle der EPBD sieht ab 2026 weitere Vorgaben vor, die auf eine digitale Durchdringung abzielen, unter anderem sollen Gebäude nach ihrer „Intelligenzfähigkeit“ bewertet werden.
„Wie die neue EPBD bis 2026 in nationales Recht umgesetzt wird, ist noch nicht sicher. Unabhängig davon ist es ratsam, sich mit dem Thema zu beschäftigen“, so Kreutze. Nicht zuletzt, weil die digitale Verfügbarkeit viele weitere Anwendungsszenarien ermögliche.