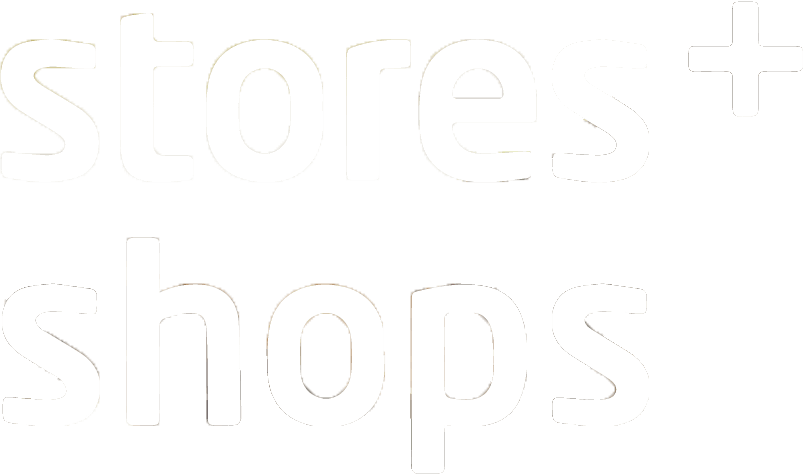Stationäre und/oder mobile Systeme: Wie wird der Handel künftig investieren?
von Lingen: Entweder stationäre SB-Kassen oder mobiles Self-Scanning anzubieten, ist der falsche Ansatz. Es geht vielmehr darum, dass jeder Händler die Lösungen einsetzt, die sich seine Kunden wünschen.
Schöttmer: Die Ergebnisse der 12. Globalen Shopper- Studie von Zebra Technologies zeigen: Technologien zum Selbstscannen werden von Kunden und Mitarbeitern immer mehr angenommen – unabhängig davon, wie Kunden ihre Einkäufe erfassen, ob mit einem mobilen Scanner oder ihrem eigenen Handy.
Völlmecke: Der Kunde wünscht, dass der Händler ihm die Customer Experience ermöglicht, die er erwartet. Diverse Faktoren wie Branche, Sortiment, Größe des Warenkorbs, Zusatzfunktionen und Hygiene beeinflussen die Entscheidung. Kein Fall gleicht dem anderen. Daher gibt es für das optimale Kundenerlebnis keine festen Cluster mehr.
Kallmeyer: Self-Scanning ist in Deutschland noch wenig verbreitet. Hier sehen wir auf jeden Fall Potenzial. Ein paralleler Einsatz beider Technologien ist durchaus sinnvoll, und Händler ergänzen traditionelle SB-Kassen gerne mit zusätzlichen mobilen Systemen. Wir gehen allerdings davon aus, dass stationäre Systeme dennoch ein deutlich höheres Potenzial haben als mobile Systeme, denn SCO ist im Vergleich sehr schnell und unterstützt sowohl Karten- als auch Barzahlung. Außerdem gibt es kaum Nutzungsbarrieren.
Die Größe des Warenkorbs bestimmt häufig, welche Lösung zum Einsatz kommt.
Martin Gebel
Sind die Kunden perspektivisch dazu bereit, beim Mobile Scanning ihr Smartphone als Erfassungsmedium einzusetzen?
Schmid: Um die Entwicklung fundiert beurteilen zu können, wären seriöse Untersuchungen zu den Nutzungsraten erforderlich. Letztlich wollen die Kunden aber weder selbst scannen noch umpacken, sondern die Ware aus dem Regal entnehmen und ohne weitere Erfassung nach Hause gehen. Generell ist Self-Scanning, ob stationär oder mobil, aus meiner Sicht eher eine Übergangstechnologie zur weiteren Automatisierung.
Schöttmer: Wir haben beobachtet, dass Kunden ihre Smartphones im Geschäft benutzten, um entweder mehr Informationen zu erhalten oder die Preise zu vergleichen. Allerdings eignet sich ein persönliches Smartphone nicht als persönlicher Einkaufsassistent – insbesondere dann nicht, wenn man alle Artikel beim Einkaufen damit einscannen möchte. Professionelle Erfassungsmedien bieten Kunden und Händlern entscheidende Vorteile: vom leistungsstarken Barcode-Scanner, der sogar beschädigte oder zerkratzte 1D- oder 2D-Barcodes erkennen kann, über verschiedene Zusatzfunktionen zur direkten Kommunikation mit dem Kunden bis hin zu Sprachsteuerung und Visible Light Communication (VLC).
Gebel: Welche Lösung zum Einsatz kommt, bestimmt häufig die Größe des Warenkorbs. Für Händler, bei denen kleinere Warenkörbe durch den POS gehen, ist eine auf Smartphones basierende Lösung häufig die einfachere. Denn sie lässt sich ohne zusätzliche Investitionen für die Hardware installieren und ermöglicht Kunden, dennoch die Vorteile von Mobile Scanning in Anspruch zu nehmen. Bei größeren Warenkörben setzen die Händler verstärkt auf professionelle Geräte. Die Gründe dafür liegen meist in der höheren Sicherheit und dem schnellen sowie anwenderfreundlichen Scanprozess. Fällt ein Gerät beim Einkauf herunter, können Anwender es dennoch weiterbenutzen und müssen sich keine Sorgen um ihr persönliches Gerät machen.
Laut Einzelhandel ist die Diebstahlgefahr beim Self-Checkout ohne zuverlässige Warensicherung deutlich erhöht.
Miguel Garcia Manso
Wann kann am SB-Checkout auf Barzahlung und damit auf die teuren Cash-Module verzichtet werden?
von Lingen: Es kann durchaus akzeptabel sein, am Self-Checkout-Terminal nur Kartenzahlung zuzulassen. Das hängt vom Produktportfolio des jeweiligen Einzelhändlers und vom Profil seiner Endkunden ab. Aber selbst bei McDonald’s gibt es immer auch noch die Möglichkeit, bar zu zahlen. Es gilt also für jeden Einzelhändler, die bekannt hohen Betriebskosten der Cash-Recycler gegen die Zufriedenheit seiner Kunden abzuwägen.
Kallmeyer: In der Regel raten wir angesichts des weiterhin hohen Bargeldanteils in Deutschland – insbesondere bei kleinen Einkäufen – und der besseren Kundenakzeptanz zu einem System mit Bargeldzahlung. Es gibt aber auch Szenarien, in denen Händler mit reiner Kartenzahlung am besten beraten sind, so beispielsweise in Geschäften mit sehr geringem Platzangebot und tatsächlich hoher Frequenz von Kartenzahlungen. Dies finden wir beispielsweise an einigen Reisestandorten.
Entweder stationäre SB-Kassen oder mobiles Self-Scanning – das ist der falsche Ansatz.
Christoph von Lingen
An welchen technischen Optimierungen von Checkout-Lösungen arbeitet Ihr Haus?
von Lingen: Für einen Einkauf, bei dem der Kunde ausschließlich Barcodes einscannt und dann bezahlt, wird im Wesentlichen nur noch Finetuning betrieben. Die Einlösung von Coupons, Omnichannel-Integration, Zusatzverkäufe und Ähnliches sind jedoch Bereiche, in denen die Optimierung weiter voranschreitet.
Völlmecke: Perspektivisch arbeiten wir an Methoden zur sensor- und datenbasierten Prozessoptimierung, um die Geschwindigkeit bei der Warenerfassung und die Prozesssicherheit zu erhöhen.
Wir gehen davon aus, dass stationäre Systeme ein deutlich höheres Potenzial haben als mobile Systeme.
Hanno Kallmeyer
Zur Diebstahlgefahr bei SB-Systemen: Kann die Technik das Risiko minimieren?
Manso: Laut Einzelhandel ist die Diebstahlgefahr beim Self-Checkout ohne zuverlässige Warensicherung deutlich erhöht. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Zum einen kann es beim Scannen der Artikel unabsichtlich zu Fehlern kommen, zum anderen schafft der Self-Checkout die Gelegenheit für spontane Diebstähle. Kunden, denen das Scannen aller Artikel zu lange dauert, erfassen nicht immer alle Produkte, die sie mitnehmen möchten und werden so zu Dieben. Und durch die fehlende persönliche Kontrolle wird es auch leichter, Ware zu verstecken und am Self-Checkout vorbeizuschmuggeln.
Schmid: Aus dem Lebensmittelhandel kenne ich keine Beispiele, die über schlechtere Inventurergebnisse nach Einführung von SB-Systemen klagen. Trotzdem gibt es genau deshalb große Vorbehalte gegen SB-Systeme. Also müssen wir Lösungen anbieten. Wir setzen Kameras und künstliche Intelligenz ein, um auffälliges Verhalten am Kassenplatz zu erkennen.
Generell ist Self-Scanning, ob statinär oder mobil, aus meiner Sicht eher eine Übergangstechnologie zur weiteren Automatisierung.
Klaus Schmid
Völlmecke: Derzeit werden bei den Herstellern und in den Testzentren von deutschen und internationalen Einzelhändlern verschiedene Methoden zur Warenerfassung und Betrugsreduktion erprobt. Computer Vision und Machine Learning sind dabei führend: Ziel ist es sicherzustellen, dass die gewählten Waren tatsächlich am Self-Checkout gescannt werden, um beispielsweise „Sweethearting“ zu vermeiden. Algorithmen können zusätzlich erkennen, wie lange sich Konsumenten in bestimmten Bereichen der Filiale aufhalten, und eine Prüfung des Warenkorbs veranlassen, wenn aus diesem Bereich kein Artikel gescannt wird.
Kallmeyer: Wir kombinieren kamerabasierte Verfahren mit selbstlernenden Algorithmen, die beispielsweise Artikel erkennen können und so den Erfassungsvorgang für den Kunden erleichtern oder nicht sicherheitsrelevante Verhaltensauffälligkeiten der Kunden ausblenden. Andererseits erkennen wir verdächtige Abläufe an der Kasse oder in der gesamten Kassenzone und können diese gezielt dem Aufsichtspersonal anzeigen, zum Beispiel wenn ein Kunde nicht alle Artikel aus dem Einkaufswagen erfasst oder nicht-organische Artikel als Obst und Gemüse erfasst.
Manso: Wichtig für Kunden und Mitarbeitende ist eine schnelle, zuverlässige und leicht zu integrierende Deaktivierung der Diebstahlsicherung am Self-Checkout. Durch die Integration eines Quellensicherungsprogramms können Einzelhändler bei RF-Etiketten eine Deaktivierungsquote von fast 100 Prozent erreichen. Im Textilbereich wird bereits in einigen Fällen RFID zur smarten Deaktivierung verwendet. Die Technologie erkennt den Status eines Artikels und kann unterscheiden, ob der Artikel beim Self-Checkout gelesen und bezahlt oder nur gelesen, aber nicht bezahlt wurde. Die smarten EAS-Antennen am Ausgang sind infolgedessen in der Lage, die gelesene, aber nicht bezahlte Ware zu identifizieren.
Professionelle Erfassungsmedien bieten viele Vorteile, sowohl für Kunden als auch für Händler.
Andreas Schöttmer Senior Account Manager Retail Zebra Technologies
Der Kunde wünscht, dass der Händler ihm die Customer Experience ermöglicht, die er erwartet.
Ulrich Völlmecke Principal Business Consultant Diebold Nixdorf