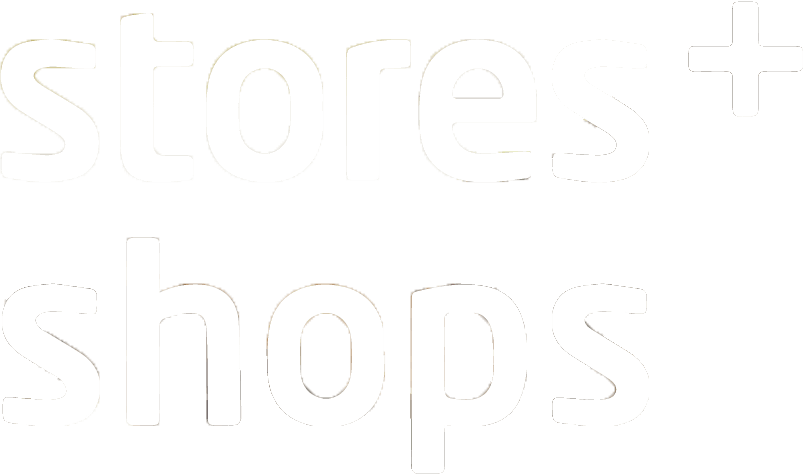Seit sich zu Beginn der 60er-Jahre das Selbstbedienungsprinzip im Einzelhandel etabliert hat, hat sich an der Grundkonstruktion und Grundfunktion eines Kassenplatzes und eines Kassentisches nur wenig geändert. Nach wie vor bestehen die Grundelemente aus einer begehbaren Einheit mit Vorrichtung zur Aufnahme der Kassentechnik, Bargeldschublade, einem Vorlaufband und je nach Ausführung nachgelagerten Rollenbahnen oder Förderbändern bzw. Packtischen.
Anders sieht es bei der zu integrierenden Kassentechnologie aus. Hier seien exemplarisch das Aufkommen von Datenkassen und Scannersystemen in den 70er-Jahren und in jüngerer Zeit die Integration von bargeldlosen Zahlungssystemen oder Checkout-Waagen genannt.
Nach wie vor ist der Kassentisch wesentlicher Bestandteil eines multifunktionalen Arbeitsplatzes mit vielschichtigen Anforderungen, den es unter betriebswirtschaftlichen, ablauforganisatorischen und ergonomischen Aspekten stetig zu verbessern gilt – wenn auch nach Aussage des Anbieters Tackenberg die gestiegene Leistungsfähigkeit sowie der zunehmende E-Commerce besonders im Nonfood-Bereich zu einem Rückgang des Bedarfs an Neugeräten geführt haben. Bei den Zusatzfunktionen sieht man andererseits einen Trend zur Vollausstattung. Der Kassentisch sei häufig vollautomatisch und unter anderem bereits mit Heizung und Windschutz versehen.
In der Kassenzone haben sich inzwischen zwei Prinzipien durchgesetzt: Modularisierung sowie ein „Alles aus einer Hand“. So sieht sich zum Beispiel das Unternehmen Harting nicht nur als reiner Kassentischhersteller, sondern als Systemintegrator für die Konzeption einer kompletten Kassenzone und kooperiert dabei projektbezogen sogar mit Impulsartikel-Produzenten. Die Modularisierung erleichtert, so Harting, die Adaptierbarkeit einer Kassenanlage an neue Vertriebskonzepte, zum Beispiel für Convenience-Konzepte in Innenstädten. Außerdem verringern sich die Anschaffungskosten für den Handel, wenn standardisierte Kassentische in größeren Mengen hergestellt und mit individueller Zusatzausstattung kombiniert werden können. Der Handel versucht natürlich, für kleinere Bestellmengen von Neugeräten die gleichen Beschaffungspreise wie für Großaufträge zu erzielen.
Bei den Grundformen eines Kassentisches sieht man beim Hattinger Anbieter Potrafke in Abhängigkeit von den Zusatzfunktionen bzw. Peripheriegeräten eher eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten. Der Hersteller ITAB stellt fest, dass bisher eher Rundformen bevorzugt wurden. Seit anderthalb Jahren sei eine Tendenz zu gradlinigeren Formen zu beobachten, dabei lägen vor allem Stahlkassentische mit Holzdekor im Trend. Generell beobachtet man auf Herstellerseite seit Längerem eine Entwicklung hin zu kundenindividuellerer Gestaltung. Darüber hinaus lässt sich bedingt durch neue Vertriebskonzepte des Handels ein steigendes Aufkommen an Express- und Stehkassen verzeichnen. Der Handel käme zudem vermehrt zu der Erkenntnis, dass die Kassenzone und damit auch der Tisch selbst optisch einen hochwertigeren Eindruck erwecken sollten.
Kurzlebigeres Design
Ein aktueller Trend bei der Kassentischgestaltung ist die stärkere Betonung der Corporate Identity des Händlers, zum Beispiel in Form von hinterleuchteten Logos als Bestandteil des Korpus. Ebenso finden sich vermehrt Holzdekore aus dem Ladenbau in der Kassenzone wieder. LED-Beleuchtungstechnologie hält auch im Kassenbereich immer mehr Einzug, darf aber aus Händlersicht nicht zu teuer sein. Die Hersteller bestätigen übereinstimmend, dass sich die „Umschlagsgeschwindigkeit“ des Designs in jüngerer Vergangenheit deutlich erhöht hat, von ehemals 7-8 zu mittlerweile weniger als 5 Jahren.
Nach Informationen aus dem Hause ITAB gerät ein Kassentischhersteller häufig in den Interessenkonflikt zwischen Serienfertigung und kundenindividueller Adaption, auch Customizing genannt. Alles, was den Kassentisch „antreibt“, zum Beispiel Förderbänder mit dazugehörigen Rahmen in standardisierten Größen, Schaltkästen, Motoren und Lichtmodule eignen sich für die Serienfertigung. Für das Customizing kommen dagegen bevorzugt Formgebung, Oberflächengestaltung und Materialien des Kassentisches in Frage. Kundenindividuell gestaltet werden häufig Packzelle und Warenplatte, Letztere, weil Scanner- und Waagenfunktion mit ihr zu verbinden sind. Dabei wird das Design meist von den Außendienstmitarbeitern gemeinsam mit den Handelskunden entwickelt.
Auch die demografische Entwicklung könnte einen Einfluss auf die zukünftige Gestaltung der Kassentische haben, denn das eher Discount-orientierte Layout aktueller Modelle steht häufig im Gegensatz zum Bedürfnis älterer Konsumenten, die Waren in Ruhe einpacken zu können und sich nicht hetzen zu lassen. Diese Sichtweise vertreten unter anderem die Kassentischhersteller Potrafke und Pillen aus Holland. Ältere Kunden bevorzugen demzufolge eher serviceorientierte Tische mit großen Mulden, bei denen auch der Kontakt zum Kassenpersonal erhalten bleibt. Außerdem sollte der Abstand zwischen den Tischen so bemessen sein, dass Einkaufswagen und Rollatoren gut durchgeschoben werden können.
Kassentische werden nachhaltiger
Das Thema Nachhaltigkeit lässt sich bei der Gestaltung von Kassentischen nach übereinstimmenden Aussagen nur in begrenztem Maße berücksichtigen, zum Beispiel durch Verwendung von Kunststoffleisten ohne Weichmacher oder PU- anstelle von PVC-Gurten auf besonderen Kundenwunsch. Die Verwendung von recyclingfähigen Materialien wie Holz oder Blech gehören dagegen seit Längerem zum Produktionsstandard. Auch im Bereich der Elektrik wurden Fortschritte erzielt, so die Verwendung von Motoren mit geringerem Stromverbrauch oder einer Abschaltautomatik bei Nichtbenutzung der Bänder. Zusätzlich unterstützt die Modularität der Kassentische das Austauschen von Einzelteilen anstelle des gesamten Kassentisches. Mehr Ansatzmöglichkeiten für Nachhaltigkeit eröffnen sich während des Produktionsprozesses durch Verwendung von umweltverträglichen Verpackungen, Minimierung von Transportwegen oder Standby-Funktionen der Produktionsmaschinen.
Eine Vielzahl neuer Technologien, die in den Kassentisch zu integrieren sind, betreffen die Bezahlvorgänge. Hierzu zählen Systeme wie Self-Scanning, Self-Payment, kontaktlose Kartenzahlung, Fingerprint-Scanner oder neue Cash-Management-Technologien. Die Bezahlvorgänge sollen immer schneller werden, der zur Verfügung stehende Platz ist oftmals begrenzt. Bei den Cash-Modulen sieht man im Unternehmen ITAB eine Tendenz zu geschlossenen Systemen, bei denen zum Beispiel das Bargeld nach Zählvorgängen in einer versiegelten Kassette aufbewahrt wird.
Die Integration der IT erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Kassentisch-Hersteller und den IT-Anbietern. Bei Self-Checkouts muss zum Beispiel die Anbindung an eine bestehende Kassensoftware erfolgen, weil darüber auch die Förderbänder gesteuert werden. Dabei liegt es im Interesse des Handels, möglichst wenige Firmen einzubinden, um den Aufwand für die Projektentwicklung zu minimieren.
Self-Scanning- und Self-Checkout-Systemen wird in Deutschland für die nächsten Jahre ein gemäßigt ansteigendes Potenzial vorausgesagt, das allerdings geringer als im Ausland sein wird. Diese Systeme eignen sich besonders für solche Märkte, die über einen hohen Anteil an Stammkunden verfügen: Man kann hier schon mal eher eine neue Technologie austesten, ohne gleich mit erheblichen Umsatzeinbußen rechnen zu müssen. Zum Erfolg von Selbstbedienungssystemen beitragen könnten auch sogenannte Hybrid-Systeme, die sich je nach Kundenfrequenz zu bedienten oder Self-Checkout-Kassen umfunktionieren lassen.
Ergonomie im Blickpunkt
Ergonomische Anforderungen spielen bei der Gestaltung von Kassentischen in Deutschland seit den 70er-Jahren, als die ersten gesetzlichen Richtlinien aufkamen, eine größere Rolle. Ergonomie sollte besonders bei der Integration innovativer Technologien ausreichend berücksichtigt werden. Die skandinavischen Länder hatten unter diesem Aspekt bereits 10 Jahre früher eine gewisse Vorreiterrolle gespielt.

Das Design der Kassentische wird meist von den Außendienstmitarbeitern gemeinsam mit den Handelskunden entwickelt. (Foto: Potrafke)
Prinzipiell müssen Kasse, Tastatur, Anzeige, Schublade und Drucker in einem möglichst engen Radius um die Kassierkraft angeordnet werden, ohne ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken. Für bestimmte Einsatzzwecke empfiehlt laut Potrafke die Berufsgenossenschaft unter ergonomischen Aspekten kombinierte Steh- und Sitzarbeitsplätze. Diese würden auch von einzelnen Händlern nachgefragt werden, als allgemeinen Trend könne man dies allerdings (noch) nicht ansehen. Bei Tackenberg sieht man eine enge Abstimmung mit den Berufsgenossenschaften bei der Weiterentwicklung von Kassentischen als gute Gelegenheit zur Profilierung im Wettbewerb. Nach Ansicht von ITAB gibt es, was die Gestaltung von Kassentischen betrifft, noch zu viele nationale Vorschriften, Maschinen und Elektrik einmal ausgenommen. Für die Zukunft erhofft man sich auf Herstellerseite mehr für ganz Europa geltende Normen.
Aktuell werden Kassentische in den verschiedenen Regionen Europas sehr unterschiedlich gestaltet, in Skandinavien zum Beispiel unter Berücksichtigung von Normen, die für Büroarbeitsplätze gelten, während in Italien der Kassenplatz eher offen gestaltet wird und häufig nur über ein Förderband verfügt. In Deutschland ist der Kassentisch meist Bestandteil einer geschlossenen Zelle, zum Teil auch mit eigenem Fußboden. Sehr wichtig ist für den Handel ein flächendeckendes Servicenetz, um Schäden und Störungen möglichst kurzfristig beheben zu können. Über die Ausgestaltung der Kassentische wird in Deutschland in der Regel in den Zentralen der Handelsunternehmen entschieden, weswegen man den in Deutschland ansässigen Herstellern aufgrund der räumlichen Nähe dort auch künftig die größten Marktchancen einräumt.
Fotos: ITAB (1), Potrafke (4)