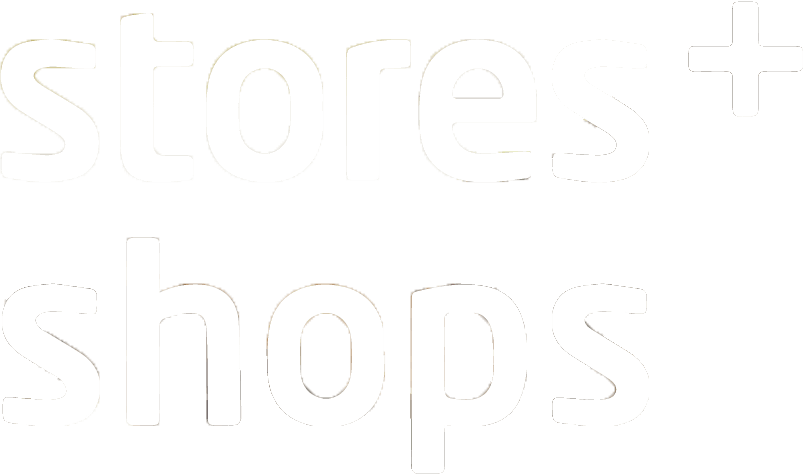Meist sind Flächen vor den Stores für den „Gemeingebrauch“ freigegeben – zum Befahren, Begehen oder kurzfristigen Parken. Alles was darüber hinaus geht ist eine „Sondernutzung“, die genehmigungspflichtig ist. „Einen Anhänger mit Werbung auf einer Parkfläche abzustellen funktioniert nicht“, erklärt Handels-Experte Hartmut Fischer. Entscheidend sei, was im Vordergrund steht – in diesem Fall die Werbung, und nicht das Parken.
Keine Sondernutzung liege jedoch vor, wenn Waren vor dem Ladenlokal ausgestellt werden – vorausgesetzt, der „Gemeingebrauch“ wird nicht behindert oder gefährdet. Als Faustregel gilt, dass Händler mit einem Abstand von rund 1,50 m vom Store-Eingang auf dem Gehsteig ausstellen können, wenn sichergestellt ist, dass Passanten – auch mit Kinderwagen – und Rollstuhlfahrer noch problemlos vorbeikommen.
Händler benötigen eine schriftliche Genehmigung zur Durchführung von Aktionen vor dem Ladenlokal. Für die Genehmigung der Sondernutzung ist bei innerörtlichen Straßen die Kommunalverwaltung zuständig. Diese vermittelt zudem, wer bei Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen dafür zuständig ist. Fischer rät, Anträge mindestens zwei Monate vor Durchführung der Aktion zu stellen, da deren Bearbeitung eine längere Vorlaufzeit benötigen.
Folgende Punkte sollten Händler in ihrem Antrag aufführen:
- Angaben zu Ihrem Geschäft (Adresse, Handelsregister-Nummer)
- Gewünschter Zeitraum der Sondernutzung
- Größe des für die Sondernutzung benötigten Areals
- Gestaltung der Sondernutzung (Warenpräsentation, Animationen usw.)
- Übernahmeerklärung für entstehende Kosten (z. B. Gebühren, Sonderreinigung)
Die Genehmigung ist meistens mit Auflagen verbunden – zum Beispiel damit, Fluchtwege offenzuhalten. Werden Auflagen nicht eingehalten, drohen Händlern Bußgelder und der Abbruch ihrer Sondernutzung.
Grundsätzlich gibt es keinen Rechtsanspruch auf Sondernutzungen. Die zuständige Behörde muss jedoch abwägen und „ermessensfehlerfrei“ darüber entscheiden. Für das Recht auf eine Sondernutzung könne beispielsweise sprechen, dass ähnliche Genehmigungen in der Nachbarschaft bereits erteilt wurden oder dass die Nutzung mit einer anderen Veranstaltung (zum Beispiel einem Stadt- oder Straßenfest) zusammenfällt. Gegen eine Genehmigung sprechen unter Umständen eine Behinderung oder Sperrung von Fluchtwegen, Zugängen für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung und Einrichtungen wie Fahrstühlen sowie eine zu erwartende Beschädigung öffentlicher Einrichtungen oder eine nicht zumutbare Lärmbelästigung.
Bei Ablehnung des Antrags besteht ein Widerrufsrecht, auf das im Ablehnungsbescheid detailliert hingewiesen werden muss. Der Widerspruch muss binnen eines Monats nach Erhalt des Ablehnungsbescheids eingereicht werden. Werde diese Frist nicht eingehalten, bestehe keine Möglichkeit mehr, den Bescheid anzufechten.
Zur Einhaltung der Frist reicht eine kurze Erklärung. Eine detaillierte Begründung kann dann nachgereicht werden. Nach Ablehnung des Widerspruchs ist noch eine Klage vor dem Verwaltungsgericht möglich. Händler müssen die Klage nach Informationen von Fischer jedoch binnen eines Monats nach Zugang der Widerspruchsablehnung einreichen. Eine Begründung des Widerspruchs sei ohne anwaltlichen Beistand nur schwer möglich. Es müsse nachgewiesen werden, dass die Ablehnung rechtswidrig ist und der Antragsteller durch die Ablehnung in seinen Rechten verletzt wurde. Sollte beispielsweise eine Weihnachtsaktion vor dem Laden im November abgelehnt werden, kann unter Umständen beim Verwaltungsgericht neben der Klage eine einstweilige Verfügung beantragt werden.
Foto: Fotolia / nicknick_ko