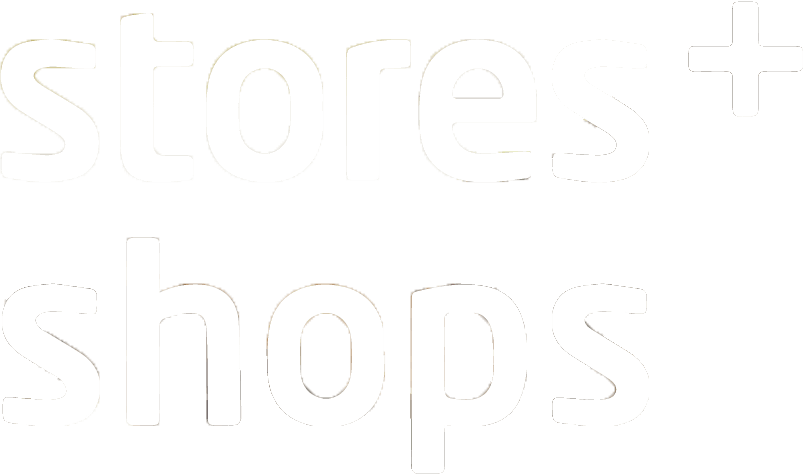Individualität und emotionale Ansprache? Viele Optiker tun sich schwer damit, die Appelle zu beherzigen, die von Einzelhändlern eher Zeitgeist-orientierter Branchen bereits zum Geschäftsprinzip erhoben wurden. Aus ihrer Sicht steht der Aufruf zu mehr Emotionalität im Widerspruch zu ihrem Auftrag. Tradition und Selbstverständnis ihrer Zunft liegen darin, als Handwerker, Techniker und medizinischer Ansprechpartner für Sehversorgung zur Verfügung zu stehen. „Vor 15, 20 Jahren sind die Optiker ihren Kunden noch im weißen Kittel gegenübergetreten“, sagt Uwe Pinhammer, einer der Inhaber von Freudenhaus Eyewear in München.
Und Detlef Becker vom Storedesigner Heikaus erinnert sich: „Früher war auch die klassische ‚Reisebüro-Anordnung‘ die Regel: An der Stelle der Reiseprospekte waren die Brillen im Rücken des Optikers und vor ihm der Tisch, an dem der Kunde Platz nahm und Brillen vorgelegt bekam.“ Inzwischen ist der Optik-Fachhandel auf dem Weg, sich von der althergebrachten Tradition zu lösen.
Das zentrale Produkt des Optikers, die Brille, hat in der jüngeren Zeit eine Metamorphose von der rezeptpflichtigen, krankenkassenfinanzierten Sehhilfe zum modisch relevanten, Marken-etikettierten Selbstausdrucksmittel mit hohem Nutzenfaktor durchgemacht. Zwar erfolgt der Kauf einer Sehhilfe nach wie vor hauptsächlich bedarfsabhängig. Dieser Bedarf hat sich stark differenziert. Es die Gleitsicht- und Lesebrillen, Sportbrillen, Autobrillen, Computerbrillen, Golferbrillen, Schützenbrillen und Brillen für Musiker. Ganz zu schweigen vom Prestigeobjekt Sonnenbrille, das strategisch an jedem Optiker-POS platziert wird.
Die Store-Planer erkennen im Optiker-Gewerbe jede Menge Nischen und verschiedene Ausdrucksformen. Tendenziell Technik-versessen und nicht immer ein leidenschaftlicher Kaufmann und Einzelhändler, fällt vielen Optikern die Fokussierung auf ausgewählte Zielgruppen oder Schwerpunktthemen jedoch schwer. „In den Briefing-Gesprächen lauten die Aussagen immer wieder: ‚Wir wollen sämtliche Altersgruppen ansprechen‘, oder: ‚Alle, die Brillen, Kontaktlinsen oder sonstige Sehhilfen brauchen‘“, berichtet Kirsten Lind von der auf Optiker spezialisierten Concept-S Ladenbau & Objektdesign.
Zwar gewährleistet ein demografisch bedingter Bedarf absehbar stabile Geschäftsaussichten. Doch Wettbewerbsdruck und der Online-Kanal fordern zugespitzte Formate, mehr Profil und eine erkennbare Positionierung eines Stores als Marke. Schließlich erwirtschafteten allein die Großfilialisten Fielmann und Apollo rund ein Viertel des Branchen-Umsatzes von 5,4 Mrd. Euro in 2013. Und Mister Spex, der Zalando des Brillen-Business, bewegt sich zwar noch auf überschaubarem Level, ist aber nicht der einzige Player, der das Online-Geschäft mit Brillen vorantreibt. „Ergo ergibt sich die Frage nach neuen Konzepten, die originell genug sind, um aus der Masse herauszustechen sowie die Frage nach der Harmonisierung von Offline- und Online-Geschäft“, sagt Kirsten Lind.
Marken- und Stilbewusstsein
In der Spitze des Marktes finden sich Beispiele von Optikern, die mit extremem Marken- und Stilbewusstsein, mit Premium-Produkten und einem CI-konformen, ausdrucksstarken Storedesign ihren Status der topmodernen Brillenmanufaktur demonstrieren, etwa Freudenhaus oder Mykita aus Berlin. Ein industrielles Schwerlastregal, ganz in Weiß gehalten, ist das Markenzeichen der puristischen Mykita-Stores zwischen NY, Berlin und Tokio. Ganz anders, aber nicht minder reizvoll, setzen die drei „Freudenhäuser“ in München auf jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und Laden-Stories, die von der Architektin Marie Aigner mit ganz unterschiedlichen Stilmitteln visualisiert werden.

Die Kinderabteilung in einer der drei Münchner Freudenhaus-Filialen zaubert ein nostalgisches Spielzimmer an die Decke.
Auch im breiten Mittelfeld der inhabergeführten Optiker regt sich Innovation. Optiker Reinhard Ruck zum Beispiel integrierte in seinen Store im österreichischen Fehring eine Puttingbahn, um den Golfern unter seinen Kunden Echtbedingungen bei der Brillenprobe zu bieten. Optiker Ganz im schwäbischen Krumbach wartet mit einem Schießstand im Laden für Jäger und Sportschützen auf. Im Freudenhaus-Flagshipstore in München gab man einer gesonderten Kinderbrillen-Abteilung ein originell verspieltes Raumkonzept, das nicht nur kindliche Ansprüche erfüllt, sondern auch die ausgefeilte Designhandschrift des Unternehmens spiegelt.
Und warum nicht die eigentliche Leidenschaft der Optiker, nämlich die Technik im Store inszenieren, fragte sich Yvonne Schmeiduch, bei Poschmann Design für Design und Marketing zuständig. „Die Tendenz zur offenen Zurschaustellung und Präsentation der Leistung des Optikers steigt. Gleich einer ‚gläsernen Fabrik‘ werden die Geräte, Refraktion oder Werkstatt offen gestaltet und die Arbeiten vor dem Kunden durchgeführt.“ Dabei geht es um mehr als die bloße Zurschaustellung, betont sie. Eingebettet in ein umfassendes „Corporate Interieur Konzept“ können die Stärken des Augenoptiker-Gewerbes nach außen kommuniziert werden, um ein Einkaufserlebnis mit Mehrwert zu erzeugen.
Verschmelzung von Off- und Online
Digitale Technologien eröffnen der Augenoptik innovative Geschäftsmodelle. Der Pionier Edel-Optics startete 2009 auf dem Online-Markt für Sonnenbrillen und ist inzwischen mit 39 Länderdomains am Start. Das Unternehmen transferierte seine virtuelle Warenauslage 2011 in einen Pilotladen in Hamburg. Dort trifft der Kunde an iPad-Panels eine Vorauswahl seiner Modell-Favoriten, die dann aus dem angrenzenden, 10.000 Marken-Modellen umfassenden Lager zur Anprobe vorgelegt wird. Glaswahl, Anpassung etc. findet durch Service-Personal und Optiker vor Ort statt.
Einige der mittlerweile gewonnenen Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt räumen mit liebgewonnenen Glaubenssätzen auf. Das Geschäftsmodell ist in 1A-Lage und unmittelbarer Nachbarschaft der großen Filialisten tragfähig. Ein älteres Publikum zeigt sich auffällig offen und interessiert. Die Selbstbedienung bei Sichtung und Auswahl der Modelle wird als angenehm empfunden. „Und durch das Signal: ‚Das macht ja Spaß‘ lassen sich Spontankäufe generieren“, sagt Sprecher Peter Berg.
Dazu als Hintergrund: Den Gang zum Optiker nehmen immer noch viele Kunden als notwendiges Übel wahr, Lust- und Impulskäufe beschränken sich hauptsächlich auf den Sonnenbrillen-Bereich. Edel-Optics treibt die weitere Verschmelzung des On- und Offline-Kanals mit den verschiedenen Spielarten von Versand und Abholservice voran. Follower sind auch schon unterwegs. In Berlin eröffnete jüngst Arena Optic mit einem ähnlichen Konzept.
Mit „Elevender“ entwickelte Concept-S für stationäre Optiker ein innovatives interaktives Display: Elektronisch gesteuert hält das Präsentations- und Lagersystem die Produkte nach dem Prinzip eines Paternosters in ständigem Umlaufbetrieb. Durch die konstante Bewegung werden alle Modelle gezeigt und der Tatsache entgegengewirkt, dass sich Ware in Schubladen schlecht verkauft. Über ein Tablet oder auch das eigene Smartphone navigiert sich der Kunde durch das Sortiment, kann Produktinformationen aufrufen und Modelle gezielt anwählen, die dann zur Anprobe entnommen werden können.
Der Online-Player Mister Spex verkündet indessen: „Brille: Online“ – in Anlehnung an den berühmten Slogan von Filialist Fielmann, während dieser erst vor wenigen Wochen bekräftigte, im Brillen-Business von jeglichen Online-Aktivitäten abzusehen, da zu beratungsintensiv. Das sehen die Online-affinen Marktteilnehmer zwar anders, räumen aber ein, dass besonders Gleitsichtbrillen nicht ohne persönliche Vermessung und Beratung angepasst werden können. Diese Erkenntnis veranlasste Mister Spex, ein Partnerprogamm ins Leben zu rufen, dem sich inzwischen um die 450 stationäre Optiker angeschlossen haben. Sie erledigen vor Ort die Dienstleistungen um die online erworbenen Brillenmodelle.
Optiker Carsten Frenz in Bremen ist einer von ihnen. Er sagt: „1.000 Euro ohne jeden Wareneinsatz, die uns Mister Spex jeden Monat überweist – warum sollte ich mir das entgehen lassen?“ Und erzählt: Innerhalb der letzten zwei Jahre als Partner-Optiker hätten lediglich 5 seiner Kunden bei Mister Spex gekauft, während „massenweise“, so Frenz, Mister Spex-Kunden zu ihm in den Laden gekommen seien.
Fotos: Poschmann Design (1), Freudenhaus Eyewear (2)
Kontakt: redaktion@ehi.org
 Individualität als Chance
Individualität als Chance
Detlef Becker, Kreativ-Chef und Geschäftsführer Architektur bei Heikaus Interior, über To-dos und No-gos im Brillengeschäft.
In Ihrer Referenz-Liste findet sich ein differenziertes Spektrum an Optiker-Stores, obwohl Optiker nun ja nicht gerade als Speerspitze der Designvielfalt gelten.
Wir wollen damit Individualität als Chance propagieren. Der Filialist muss der Masse gefallen, aber der einzelne Optiker muss das eben nicht, sondern kann sich seine Fangemeinde bilden.
Optiker denken oft eher technisch als emotional.
Ziel sollte auch beim Optiker sein, über die Emotionen zu verkaufen. Die Sonnenbrille ist zum modischen Must-have avanciert und muss entsprechend präsentiert werden. Ebenso unterliegt die Korrektionsbrille bzw. die klassische Brillenfassung heute dem Zeitgeist.
Bei aller Individualität – wie werden Brillen heute ideal präsentiert? Gibt es so etwas wie Grundregeln der Präsentation?
Für den Kunden bedienungsfreundlich. Der Kunde muss sich frei und ungehindert im Laden bewegen können und ein Nur-mal-Schauen muss jederzeit möglich sein. Dabei dürfen dem Kunden keine Bedenken kommen, eine Brille in die Hand zu nehmen. Das heißt, Brillen sollten am besten auseinandergeklappt liegend präsentiert werden. Grundsätzlich gilt zu beachten, dass dieses kleine, filigrane Produkt Brille klar, übersichtlich und deutlich, in der Regel vor neutralem, hellem Hintergrund präsentiert werden muss. Im Sonnenbrillenbereich halten wir eine hinterleuchtete Präsentation grundsätzlich für besonders wirksam und emotional, da dann die unterschiedlichen Farben der Gläser schön zum Ausdruck kommen.
Und in Bezug auf die Raumteilung?
Die Beratung sollte in ruhigen Zonen, ungestört von Laufkundschaft und Kasse liegen. Die Lage von Untersuchungsbereich, Werkstatt und Kasse muss so angeordnet sein, dass Überschneidungen der Laufwege und zu lange Wege vermieden werden.