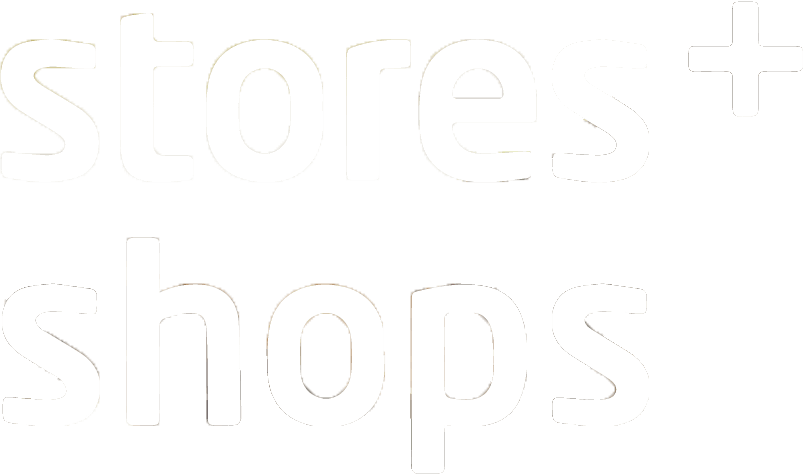„Es sollte im Vorfeld klar sein, worauf man sich einlässt.“ Das kann Martin Eisenblätter, Diplom-Ingenieur, Architekt und Partner des Unternehmens Brandscouts aus Telgte allen Einzelhändlern nur raten. Die Realität sehe indes manchmal anders aus. „Expansionsteams haben Zielstädte, Lagen und Mietspiegel im Visier, weniger aber Baurecht, Denkmal- und Brandschutz. Sie unterschreiben Mietverträge, und ab dann laufen die Kosten.“

Im Modehaus Garhammer in Waldkirchen wurden Teile der ehemaligen Stadtmauer als Gestaltungselement in die Verkaufsfläche integriert.
Foto: Heikaus
Auch Angela Kreutz, Unternehmssprecherin des Stuttgarter Architekturbüros Blocher Partners, empfiehlt: „Gerade bei geplanten Neueröffnungen ist eine Machbarkeitsstudie im Vorfeld oftmals sinnvoll. Wurde die Immobilie zuvor noch nicht für Retail genutzt, muss die Prüfung mitunter sogar bei der Frage beginnen, ob sich der Standort überhaupt als Handelshaus eignet, ob es beispielsweise erlaubt ist, falls noch nicht vorhanden, Schaufenster in die Front zu integrieren. Weiterer Vorteil einer Voruntersuchung: der Bauherr erhält eine grobe Schätzung der Baukosten.“
Eine solche Schätzung kann laut Martin Eisenblätter auch deshalb nur grob sein, da Vorgaben des Denkmalschutzes des Öfteren mit denen der Energieeinsparverordnung oder des Brandschutzes, zum Beispiel ungeschützte Holzbalkendecken, kollidieren. Was dann Vorrang hat und welche Lösungen möglich sind, darüber stehen dann jeweils Einzelfallentscheidungen an, die zeitaufwändig sind. Markus Hintzen, Head of Architecture+FM des Modeunternehmens Orsay, sagt dazu: „Vertikale Filialisten wie wir mieten Immobilien mit Denkmalschutz nur bedingt an. Planungs-, Fassaden- und Layout-Standards können nur schwer umgesetzt werden. Zudem ist die Kosten- und Bauzeitplanung unberechenbar.“
Besonderer Reiz
Es ist also auch immer die Frage, welches Genre eine unter Denkmalschutz, Ensembleschutz oder einer Altstadtsatzung stehende Immobilie beziehen möchte. „Für hochwertig ausgerichtete Geschäfte kann das, was das Denkmal auszeichnet, gerade den Reiz ausmachen und sehr positiv auf die Marke einzahlen“, ist Martin Eisenblätter überzeugt.

Die Gewölbedecke des Wäschegeschäfts Maute-Benger in Stuttgart trägt in hohem Maße zum Ambiente bei, erfordert aber auch viel Kreativität bei der Einrichtungsplanung
Foto: Heikaus
Auch Holger Moths von Prof. Moths Architekten aus Hamburg ist der Meinung: „Meist umgibt das denkmalgeschützte Ladenlokal bereits ein sehens- und erlebenswertes Umfeld in historischem Kontext, das die Kunden überhaupt erst in die jeweilige Stadt zieht. Darin sehe ich ein großes und tatsächlich auch durch Restriktionen zu schützendes Kapital. Es ist für die Innenstadtqualität elementar wichtig und gut so, dass es zum Beispiel in Passau anders aussieht als in Flensburg und dass, beginnend bei der Außenwerbung, nicht alles erlaubt ist.“
Was die Stores angeht, meint Moths: „In denkmalgeschützten Stores selbst bekommt man dann als Einzelhändler vielfach eine Einzigartigkeit geschenkt, beispielsweise in Form von Wand- oder Deckenmalereien, Stuck oder ornamentalen Verzierungen, für die man ladenbaulich eine Menge tun müsste, wollte man einen vergleichbaren atmosphärischen Effekt erzielen. Das ist etwas Besonderes in dieser Zeit, in der Läden sehr uniform sind.“ Wichtig ist aus Sicht von Moths, dass man das, was ein Denkmal auszeichnet, „annimmt und ihm Raum gibt, damit es wirkt.“
Blocher Partners ist für viele Traditionsmodehäuser tätig und hat daher nicht nur häufig mit mehrfach erweiterten Gebäuden zu tun, sondern auch mit den regional variierenden Auflagen des Denkmalschutzes. Wie beim Umbau des Modehauses Garhammer in Waldkirchen: Hier integrierten die Architekten als Gestaltungselement die rohe Stadtmauer in die Verkaufsfläche.
Auch bei Juhasz in Bad Reichenhall wurden Stadtmauer-Relikte über zwei Geschosse deutlich sichtbar in den Erweiterungsneubau eingefügt. Dieser profitiert von der individuellen Note und den Kontrasten zwischen historischen und modernen Elementen.
Integrierte Stadtmauer

Stadtmauer-Relikte geben dem Erweiterungsneubau im Modehaus Juhasz in Bad Reichenhall etwas ganz Besonders
Foto: Heikaus
Ähnlich handhabte es das Ladenbauunternehmen Heikaus beim Umbau des Stuttgarter Wäschefachgeschäfts Maute-Benger. Das Gebäude, das dem Land Baden-Württemberg gehört, hat einen über 400 Jahre alten Stiftskeller. Das alte Mauerwerk und die aufwändig freigelegte Gewölbedecke wurden in das Ladendesign integriert. Da die Wandflächen nicht zur Warenpräsentation genutzt werden dürfen, kam den Mittelraumelementen besondere Bedeutung zu. Das flexible System kann große Warenmengen aufnehmen und die fehlenden Rückwandflächen kompensieren.
Das Beleuchtungskonzept wurde speziell für den Raum entwickelt. Schwarze Ricks spannen sich von Stütze zu Stütze und bilden ein filigranes „Beleuchtungsdach“, das sowohl die Ware als auch das spektakuläre Gewölbe ausleuchtet.
Kreativität ist also gefragt. Auch wenn laut Martin Eisenblätter manchmal sogar originalgetreue Steckdosen vorgeschrieben sind – Holger Moths sieht das Thema trotzdem entspannt. Oftmals gehe es nicht um teure Restaurierungen. Daher gelte es, zunächst zu hinterfragen, was genau unter Denkmalschutz steht. „Denn das ist ja oftmals nicht das ganze Haus, sondern etwa nur die Fassade, eine Treppe im Inneren oder ein Oberlicht.“ Denkmalschutzämter sind, so Moths, keine Behörden, die zu allen Veränderungen kategorisch „nein“ sagen. Moths: „Sie sind meist bemüht, ein Denkmal für die Öffentlichkeit nutz- und sichtbar zu machen und haben nicht die Absicht, es museal zu isolieren. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich im konstruktiven Dialog oft gute Kompromisse finden lassen.“ Last, but not least, unterstützen teilweise finanzielle Zuwendungen aus Mitteln der Denkmalpflege bei der rhaltung der Objekte.