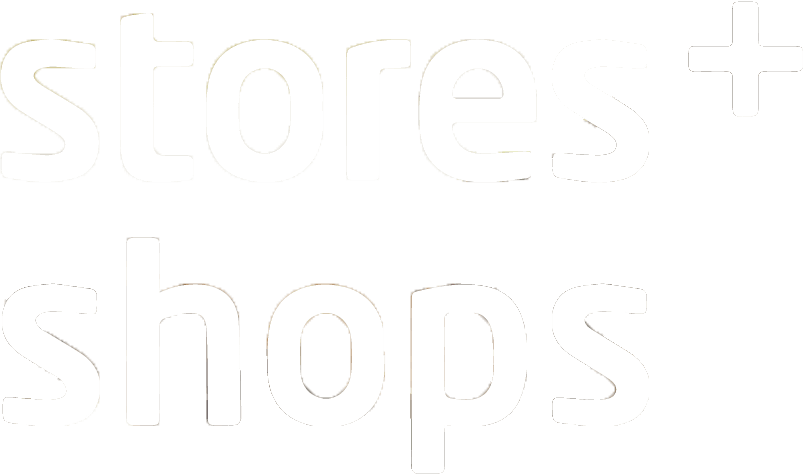Herr Wanzl, wie beurteilen Sie die derzeitige Investitionsbereitschaft des Handels bei Einkaufswagen?
In Deutschland und Europa beobachten wir momentan eine eher zurückhaltende Investitionsbereitschaft im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig sind die Anforderungen an die Qualität und das Ausstattungsniveau von Einkaufswagen gestiegen. Sehr zufrieden sind wir mit der Entwicklung in Asien. In China, wo wir seit dem Jahr 2000 Einkaufswagen produzieren, haben wir zuletzt eine Jahresstückzahl von 350.000 Einheiten erreicht. Etwa 40 Prozent verbleiben im chinesischen Absatzmarkt, 60 Prozent werden nach Südostasien, Australien und in den Mittleren Osten verkauft. Die Wachstumsrate in China liegt bei 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Verschiedene Hersteller aus China produzieren Einkaufswagen für den europäischen Markt. Spüren Sie die Konkurrenz aus Fernost?
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen lassen derzeit keine Exportsprünge chinesischer Anbieter erwarten. In den letzten drei Jahren sind die Lohnkosten in China um je 15 bis 18 Prozent gestiegen. Für die Firmen dort, die eher arbeits- als kapitalintensiv arbeiten, ein zunehmendes Problem. Hinzu kommt, dass die chinesische Währung gegenüber dem Euro und dem US-Dollar in den letzten Jahren stark aufgewertet wurde. Unter diesen Bedingungen macht es wenig Sinn, aus China zu importieren.
In Europa werden die privaten Haushalte immer kleiner, die Verbraucher kaufen häufiger, aber in kleineren Mengen ein. Wie spiegeln sich diese Trends in Ihrem Einkaufswagen-Sortiment wider?
Unsere Produktpalette an Einkaufswagen umfasst generell ein sehr breites wie tiefes Sortiment, vom kleinen „City-Shopper“ bis hin zum großen Einkaufswagen für den Wochenend-Einkauf. Für kleinere Einkäufe haben wir schon vor einigen Jahren den „Light-Einkaufswagen“ entwickelt. Die Idee kam aus England. Super- und Hypermärkte stellen ihren Kunden dort zusätzlich zum großvolumigen Einkaufswagen kleinere Wagen zur Verfügung, ohne Kindersitz und mit nur 100 Liter Korbvolumen. Diese Wagen werden auch von Singles und Senioren gerne genutzt. Mittlerweile stellen auch einige deutsche Supermarkt- und SB-Warenhausbetreiber ihren Kunden solche Zweiteinkaufswagen zur Verfügung. In England können die Kunden beim Einkauf nicht selten aus 6, 7, 8 oder sogar 10 verschiedenen Wagentypen auswählen, zum Beispiel elektrisch betriebene Aufsitz-Einkaufswagen für behinderte Menschen oder Einkaufswagen mit Doppel-Kindersitz. Da England für uns ein Kernmarkt ist, lernen wir von den Trends dort und sind so auf entsprechende Entwicklungen in anderen Absatzmärkten vorbereitet.
Für kleinere Einkäufe halten viele Supermärkte Kunststoffkörbe bereit, die man tragen oder hinter sich herziehen kann.
Dieses sogenannte „Shop and Roll“ ist nach meiner Einschätzung ein gewisser Modetrend. Die Nachteile beim Handling überwiegen. Die in den Korb abgelegten Lebensmittel befinden sich in Bodennähe, also im Schmutzbereich, was hygienisch bedenklich ist. Am Kassenplatz muss sich der Kunde bücken, um die Körbe dann auf das Kassenband zu hieven und um die Artikel auf das Kassenband zu legen. Wir haben uns daher entschlossen, nicht in dieses Segment zu investieren. Wer diese Körbe im Einsatz hat, wird sich früher oder später wieder davon abwenden. Für den Kunden ist es zwar praktisch, dass die Körbe kein Münzpfandsystem haben. Der Handel könnte aber alternativ zu den Rollkörben kleine Einkaufswagen ohne Pfandsystem zur Verfügung stellen und durch geeignete diebstahlhemmende Maßnahmen sicherstellen, dass diese Wagen nur im Markt zirkulieren.
Auch der Einkaufswagen der Zukunft wird vier Rollen haben.
Als Hersteller klassischer Einkaufswagen aus Metall ist Ihr Unternehmen seit einigen Jahren auch im Marktsegment der Kunststoff-Einkaufswagen präsent. Welche strategische Bedeutung hat dieses Segment für Ihr Unternehmen und wie beurteilen Sie die Marktperspektiven?
Als in den 90er-Jahren verschiedene Spezialanbieter für Kunststoff-Einkaufswagen den Markt betraten, wollten wir diese Marktlücke natürlich nicht unbesetzt lassen. Bei der Entwicklung des „Tango“, den wir seit nunmehr zehn Jahren anbieten, standen vor allem Design-Aspekte im Vordergrund. Unsere Kunden aus dem Handel ordern diesen Wagen, um sich von der breiten Masse abzuheben. Ich glaube, das ist das vorrangige Motiv. Ein Trend zum Kunststoff-Einkaufswagen ist zwar nach wie vor zu beobachten, es ist aber kein wachsender Trend.
Welchen Marktanteil haben Kunststoff-Einkaufswagen bei Wanzl, und wer sind für Sie die wichtigsten Kunden?
Etwa zehn Prozent unserer Einkaufswagen, die wir für den Handel produzieren, haben einen Kunststoffkorb. Hauptabnehmer sind große, internationale Handelsketten wie Ahold, Auchan oder Carrefour. In Deutschland setzen einige selbstständige Lebensmittelhändler auf den „Tango“, zum Beispiel solche, die Toplagen in Innenstädten besetzen.
Ein Argument für den Kunststoffkorb ist die Recyclingfähigkeit des Materials. Werden ökologische Aspekte bei der Investitionsentscheidung von Ihren Kunden thematisiert?
Nachhaltigkeit spielt in der Tat eine zunehmend wichtige Rolle für unsere Kunden. Für einen großen Handelskunden in Südafrika beispielsweise war es wichtig, dass der Kunststoffkorb überwiegend aus Recycling-Material hergestellt ist. Tatsächlich ist es je nach Größe der Körbe möglich, bis zu 75 Prozent Recycling-Material beizumischen. Man muss allerdings in Kauf nehmen, dass nur relativ dunkle Farben wie Anthrazit-Grau oder Schwarz möglich sind. Einen Beitrag zur Umwelt kann man aber auch mit Einkaufswagen aus Metall leisten. In jeder Tonne Stahl, die wir für die Produktion von Einkaufswagen verwenden, ist etwa 30 bis 40 Prozent Recycling-Material beigemischt. Stahl ist also im Prinzip ein Recycling-Material.
Mit der herkömmlichen RFID-Technologie ist das Warensortiment eines Supermarkt-Einkaufskorbes erkennungstechnisch nicht abzubilden.
Die Anwendung der Radiofrequenz-Technologie zur Artikelidentifizierung am Checkout kann am POS nur mit Einkaufswagen aus Kunststoff funktionieren, da Metall die Sendersignale abschirmt. Glauben Sie, dass sich RFID durchsetzen wird und die Materialfrage somit entscheidend beeinflussen könnte?
Die RFID-Thematik sehe ich unabhängig vom Material der Einkaufswagen. Viele Artikel, die im Einkaufswagen landen, von der Konservendose über Alufolien bis hin zu vielen anderen Nonfood-Artikeln, enthalten Metall. Eine hundertprozentige Auslesbarkeit der Artikelpreise ist wegen der hohen Metall-Anteile im Warensortiment daher nicht möglich. Für die Anwendung der RFID-Technik im Handel gibt es noch physikalische Grenzen.
Einkaufswagen zählen zu den Investitionsgütern mit relativ langen Innovationszyklen. Wo sehen Sie mittelfristig noch Ansatzpunkte für Weiterentwicklungen?
Ein Systemprodukt wie der Einkaufswagen muss auch in 10 oder 15 Jahren noch zu vernünftigen Preisen nachlieferbar sein. Er muss darüber hinaus bestimmte Sicherheitskriterien erfüllen und kompatibel mit der bestehenden Flotte sein. Das alles wird nach meiner Einschätzung dazu führen, dass es in absehbarer Zeit keine großen Innovationsschübe geben wird. Als Marktführer fühlen wir uns natürlich verpflichtet, technische Entwicklungen und Trends genau zu beobachten, zu analysieren und daraus Ideen abzuleiten. Hierbei handelt es sich häufig um Detaillösungen, die kundenindividuell entwickelt werden, wie beispielsweise eine besondere Griffform, Zubehör oder besondere Designelemente.
Das Interview führte Winfried Lambertz.
Fotos (2): Wanzl
Wanzl: Auf Draht
Gottfried Wanzl (57) vertritt als Geschäftsführender Gesellschafter die dritte Generation des im Jahre 1947 gegründeten Familienunternehmens mit Hauptsitz in Leipheim. Sein Vater Rudolf Wanzl erfand vor mehr als 60 Jahren den Urtyp des Einkaufswagens in seiner bis dato kaum veränderten Form. Heute ist die Wanzl Metallwarenfabrik GmbH der größte Hersteller von Einkaufswagen weltweit. Pro Jahr werden rund 2,8 Mio. Stück in einer Fülle von Modellvariationen produziert und verkauft. Das Unternehmen erwirtschaftete 2011 mit 4.000 Mitarbeitern, davon 2.400 in Deutschland, einen Umsatz von ca. 440 Mio. Euro. Wanzl ist mit 11 Werken in 7 Ländern vertreten und unterhält weltweit 21 Vertriebsniederlassungen.
Weitere Informationen: www.wanzl.de